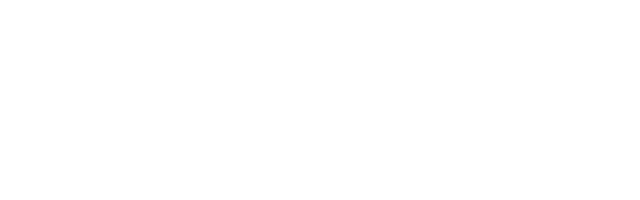M&A-Strategien für Verkäufer auf Exit-Kurs: Verkaufen, beteiligen oder bleiben?

Unternehmer, Gründer und Familienunternehmen, die einen Unternehmensverkauf oder die Nachfolgeplanung angehen, stehen vor einer grundlegenden Frage: Was ist die beste Exit-Strategie für meinen Fall?
Fest steht, dass es nicht die eine Lösung für alle gibt. Die optimale M&A-Strategie hängt immer von den Zielen des Verkäufers, der Unternehmenssituation und den persönlichen Vorstellungen ab.
Während früher der klassische 100 %-Exit dominierte, rücken heute differenziertere Modelle in den Fokus. Ob vollständiger Verkauf, Teilbeteiligung oder Management-Nachfolge – entscheidend ist, die passende Strategie frühzeitig zu planen und professionell umzusetzen.
Im Folgenden beleuchten wir die drei häufigsten verkäuferseitige M&A-Strategien im Mittelstand – die vollständige Exit-Strategie (Komplettverkauf), Teilverkauf (Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung) sowie Management-Buy-Out oder -Buy-In (MBO/MBI) – und erklären, was sie bedeuten, für wen sie geeignet sind, welche Chancen und Risiken sie bergen, welche Erfolgsfaktoren zählen und welche Trends und Praxisbeispiele es aktuell gibt.
1. Vollständiger Exit: Verkauf von 100 % der Anteile
Was bedeutet ein vollständiger Exit?
Ein vollständiger Exit bezeichnet den kompletten Verkauf des Unternehmens. Der Eigentümer („Verkäufer“) veräußert 100 % der Firmenanteile an einen neuen Eigentümer und scheidet damit vollständig aus dem Unternehmen aus. Diese Komplettübergabe erfolgt meist an einen strategischen Käufer (z.B. einen Branchenkollegen oder Wettbewerber) oder an einen Finanzinvestor (etwa Private-Equity-Gesellschaft oder Family Office).
Für den Verkäufer bedeutet ein Exit, sein „Lebenswerk“ in neue Hände zu geben – sei es aus Altersgründen, mangels Nachfolger in der Familie oder um den Wert des Unternehmens zu realisieren. Viele Gründer und Inhaber stellen sich die Frage, ob ein Vollverkauf der richtige Schritt ist.
Für wen eignet sich eine Exit-Strategie?
Eine Exit-Strategie eignet sich vor allem für Unternehmer, die einen klaren Schnitt machen wollen. Es sind häufig langjährige Inhaber kurz vor dem Ruhestand oder Serial Entrepreneurs, die sich neuen Projekten widmen möchten. Auch Start-up-Gründer mit Investoren im Hintergrund planen oft einen Exit, um die angelegte Wertschöpfung auszuzahlen (im Mittelstand ist dies seltener der Fall).
Kurz: Eine Exit-Strategie ist immer dann passend, wenn der Verkäufer komplett aussteigen und die Verantwortung vollständig abgeben möchte.
Was sind die Chancen und Vorteile eines Vollverkaufs?
Ein erfolgreicher Exit bietet dem Verkäufer in der Regel maximale Liquidität und Entlastung. Der gesamte Verkaufswert fließt – zumindest zum großen Teil – dem Verkäufer sofort zu, was beispielsweise der Altersvorsorge oder neuen Investitionen dient.
Zudem ist die Nachfolgefrage sofort gelöst: Der Käufer übernimmt das Steuer. Verkauft man an einen strategischen Investor (z.B. ein größeres Unternehmen der gleichen Branche), kann dies Vorteile bringen wie den Erhalt von Arbeitsplätzen und eine Fortführung im Sinne des Firmenzwecks. Strategen zahlen mitunter sogar Preisaufschläge für Synergien, da Ihr Unternehmen deren Portfolio ergänzt.
Wer hingegen den Verkauf mit einem Finanzinvestor oder Private-Equity-Partner gestalten möchte, bewegt sich meist in Richtung Teilverkauf. Diese Option beleuchten wir im nächsten Abschnitt.
Ein Verkauf an einen Finanzinvestor wiederum kann strukturierter ablaufen: Private-Equity-Investoren bringen oft Professionalität in den Prozess und ziehen erfahrene Manager hinzu, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Für den Verkäufer besteht hier manchmal die Möglichkeit, in einer Übergangsphase beratend mitzuwirken, um einen reibungslosen Eigentümerwechsel zu gewährleisten.
Was sind die Erfolgsfaktoren für einen gelungenen Exit?
Damit ein Exit erfolgreich wird, sollten folgende Faktoren auf Verkäuferseite unbedingt beachtet werden:
- Gründliche Vorbereitung
Käufer erwarten vollständige, nachvollziehbare Unterlagen. Dazu zählen eine saubere Buchhaltung, aktuelle Verträge und belastbare Planungen. - Perspektivwechsel einnehmen
Wer sein Unternehmen verkauft, sollte wie ein Käufer denken: Wo liegen Risiken? Was muss erklärt, was transparent gemacht werden? - Abhängigkeiten reduzieren
Unternehmen, die zu stark auf den Gründer zugeschnitten sind, schrecken Käufer ab. Ein starkes Managementteam und dokumentierte Prozesse schaffen Unabhängigkeit. - Marktgerechte Bewertung
Der emotionale Wert des Unternehmens und der Marktpreis stimmen selten überein. Ein Gutachten und externe Beratung sorgen für Realismus und Klarheit. - Erfahrener M&A-Berater
Ein guter Berater strukturiert den Verkaufsprozess, erstellt professionelle Unterlagen und führt gezielt Gespräche – das erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit und den Preis. - Käuferwettbewerb schaffen
In kontrollierten Auktionsprozessen werden mehrere Käufer parallel angesprochen. Das verbessert die Verhandlungsposition des Verkäufers deutlich. - Timing bewusst wählen
Der beste Zeitpunkt für einen Verkauf ist nicht das geplante Rentenalter, sondern eine Phase starker Unternehmensperformance und günstiger Marktdynamik.
M&A-Strategie Exit: Aktuelle Trends 2025
Im Jahr 2025 sind Externalisierungen von Unternehmen an der Tagesordnung. Viele Konzerne fokussieren sich aufs Kerngeschäft und kaufen Mittelständler zu, oder stoßen selbst Teilbereiche ab – was wiederum Übernahmemöglichkeiten für (Finanz-)investoren schafft.
Für Mittelstandsinhaber bedeutet das: Es gibt reges Käuferinteresse, sowohl seitens strategischer Käufer (die Marktanteile, Kundenzugang oder Technologien zukaufen möchten) als auch von Finanzinvestoren mit hohem Kapitalbestand. Die Bewertungsniveau sind in einigen Branchen noch immer hoch, wenn auch unter früheren Rekorde. Käufer sind 2025 etwas selektiver und fokussieren auf nachhaltige Wertsteigerung.
2. Teilverkauf: Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung verkaufen
Was bedeutet ein Teilverkauf?
Ein Teilverkauf der Firma heißt, dass der Eigentümer nur einen Teil der Geschäftsanteile veräußert, anstatt alles auf einmal.
Es gibt zwei Hauptvarianten:
- Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung (der Käufer erwirbt >50% und damit die Kontrolle, während der Alt-Eigentümer eine Minderheit behält)
- Verkauf einer Minderheitsbeteiligung (der Käufer erwirbt <50%, der bisherige Eigentümer bleibt Mehrheitseigner und Hauptentscheidungsträger).
Praktisch gesehen sind Teilverkäufe oft flexible Nachfolgelösungen.
Beim Mehrheitsverkauf holt sich der Unternehmer einen neuen Hauptgesellschafter ins Boot, bleibt aber mit kleinerem Anteil (und häufig in einer Übergangsrolle) weiter verbunden.
Beim Minderheitsverkauf kommt ein Investor als Partner hinein, während der ursprüngliche Inhaber weiter die Geschicke leitet. Oft mit dem Ziel, Kapital fürs Wachstum zu gewinnen oder den Wert zu steigern, bevor später ein vollständiger Exit folgt. Besonders Private-Equity-Investoren bevorzugen solche Modelle: Sie steigen selten mit 100 % ein, sondern verlangen meist eine Rückbeteiligung des Unternehmers („Reinvestment“). So bleibt der Verkäufer während der Übergangsphase an Bord – finanziell wie operativ –, was Vertrauen schafft und die Interessen beider Seiten ausgleicht.
Für wen ist ein Teilverkauf geeignet?
Diese Strategie passt zu Unternehmern, die nicht sofort komplett aussteigen möchten oder können. Vielleicht möchten sie schrittweise die Nachfolge regeln, zunächst einen Partner beteiligen und erst in ein paar Jahren endgültig übergeben. Oder sie brauchen frisches Kapital, um Expansionsschritte zu finanzieren, ohne gleich die ganze Firma aufzugeben.
Ein Teilverkauf der Firma kann auch sinnvoll sein, wenn Sie zwar einen Teil Ihres Vermögens sichern wollen (Cash-out), aber weiterhin an der zukünftigen Entwicklung teilhaben möchten. Familienunternehmen nutzen Teilverkäufe zum Beispiel, um Eigenkapital für Wachstum zu generieren oder um Erbstreitigkeiten zu vermeiden, indem ein externer Investor Anteile übernimmt und professionalisiert.
Ein Mehrheitsverkauf bietet sich an, wenn ein starker Partner die Führung übernehmen soll, der Alteigentümer aber als Berater oder Minderheitsgesellschafter noch mitwirken will. Minderheitsbeteiligungen sind eher geeignet, wenn der Inhaber die Kontrolle behalten will und gezielt nur Kapital und Know-how einkaufen möchte. Oft sind Private-Equity-Investoren bei solchen Modellen involviert: Sie steigen entweder mehrheitlich ein (der Unternehmer rollt einen Anteil weiter) oder als Minderheitsgesellschafter.
Vor allem für Nachfolgesituationen im Mittelstand hat sich Private Equity als Option etabliert.
Was sind die Chancen und Vorteile eines Teilverkaufs?
Der größte Vorteil hybrider Beteiligungsmodelle ist ihre Flexibilität.
Verkäufer realisieren einen wesentlichen Teil des Unternehmenswerts, behalten aber – je nach Modell – Anteile und Einfluss. Das reduziert Klumpenrisiken, schafft Liquidität und ermöglicht zugleich die Beteiligung am künftigen Erfolg, etwa durch steigende Bewertungen unter neuer Führung.
Bei einem Minderheitsverkauf bleibt der Verkäufer operativ in der Verantwortung, erhält frisches Kapital für Wachstum (z. B. neue Märkte oder Übernahmen) und profitiert vom Know-how des Investors – etwa bei Strategie, Digitalisierung oder Controlling.
Ein Mehrheitsverkauf bedeutet zwar Kontrollabgabe, läuft jedoch meist übergangsweise: Verkäufer bleiben oft noch als Geschäftsführer oder Berater an Bord, um Know-how zu sichern.
Zusätzlicher Anreiz: Ein Teilverkauf kann zu einem zweiten Exit führen. Beispiel: 70 % gehen an einen Investor, 30 % bleiben. Steigt der Unternehmenswert, lassen sich die restlichen Anteile später oft teurer veräußern. Auch strategische Investoren nutzen dieses Modell, um Gründerwissen im Unternehmen zu halten.
Zusammengefasst: Teilverkäufe kombinieren Liquidität, unternehmerische Kontinuität und strategisches Upside.
Risiken und Herausforderungen
Ein Teilverkauf bringt finanzielle Vorteile, birgt jedoch strukturelle und kulturelle Risiken, die frühzeitig bedacht werden müssen. Die wichtigsten Herausforderungen:
- Interessenkonflikte durch geteilte Eigentümerschaft
Wo zwei Gesellschafter sind, gibt es potenziell zwei strategische Agenden. Beim Minderheitsverkauf behalten Sie zwar formal die Kontrolle, müssen aber mit dem neuen Partner abstimmen, wie das Unternehmen geführt wird. Der Investor verfolgt in der Regel das Ziel, seine Beteiligung mittelfristig mit Gewinn zu veräußern – die Unternehmensstrategie muss diesen Exit-Gedanken mitdenken. Unterschiedliche Zeiträume oder Prioritäten (z. B. langfristiges Wachstum vs. kurzfristige Rendite) können zu Spannungen führen. - Kontrollverlust bei Mehrheitsverkauf
Wer die Mehrheit abgibt, gibt auch das letzte Wort ab. Als Minderheitsgesellschafter befinden Sie sich in einer ungewohnten Rolle: Entscheidungen können gegen Ihre Überzeugung getroffen werden. Umso wichtiger ist es, vertraglich Mitspracherechte, Vetos und Informationspflichten klar zu definieren. Sonst droht der faktische Kontrollverlust über Ihr eigenes Lebenswerk. - Kultureller Wandel und Verunsicherung im Team
Ein neuer Eigentümer bringt oft neue Werte, Prozesse und Führungsstile mit. Für Mitarbeiter – insbesondere in familiengeführten Unternehmen – kann das ein Bruch sein. Wenn z. B. ein Finanzinvestor Mitspracherechte erhält oder ein strategischer Käufer weitreichende Umstrukturierungen plant, leidet nicht selten die Identifikation mit dem Unternehmen. - Operativer Mehraufwand durch Reporting und Gremien
Gerade bei Minderheitsbeteiligungen steigt der Aufwand im Tagesgeschäft. Investoren erwarten regelmäßige Reportings, wollen KPIs sehen, sitzen mit im Beirat oder fordern ein stärker formalisiertes Controlling. Das bringt zusätzliche Komplexität und Bürokratie mit sich. - Unklare Exit-Regelungen für den zweiten Schritt
Jeder Investor plant früher oder später den Ausstieg. Ist nicht klar geregelt, wie dieser zweite Exit funktioniert, entstehen Unsicherheiten. Typische Klauseln wie Drag-Along (Pflicht zur Mitveräußerung) oder Tag-Along (Recht auf Mitverkauf) sollten bekannt und verstanden sein – sonst kann es später zu Konflikten oder Wertverlust kommen.
Erfolgsfaktoren bei Teilverkauf-Strategien
- Der richtige Partner
Ein Investor sollte nicht nur Kapital mitbringen, sondern auch zum Unternehmen und zur Kultur passen. Gemeinsame Werte und ein ähnliches Verständnis von Strategie und Wachstum sind entscheidend. - Mehrwert über Geld hinaus
Ein guter Partner bringt Know-how, Netzwerke oder Managementexpertise mit. Das erhöht den strategischen Nutzen der Beteiligung deutlich. - Präzise Vertragsgestaltung
Die Rollen und Entscheidungsrechte müssen klar geregelt sein: Wer darf was entscheiden, wann ist Zustimmung nötig, wie ist ein späterer Exit strukturiert? - Gemeinsame Zielbilder und Anreizsysteme
Klare Vereinbarungen zu Wachstum, Performance-Zielen oder Folgeinvestitionen fördern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit – z. B. über Bonusmodelle oder Meilensteinzahlungen. - Gute Kommunikation nach innen und außen
Ein Teilverkauf muss erklärt und eingeordnet werden – für Mitarbeitende und Kunden. Wer transparent kommuniziert, schafft Sicherheit und verhindert Missverständnisse. - Integration und Aufgabenteilung
Der Investor sollte gezielt eingebunden werden, z. B. über Beiräte oder klare Verantwortlichkeiten (z. B. Finanzen beim Investor, operative Führung beim Alt-Eigner). - Offenheit und Selbstbewusstsein
Neue Impulse zulassen, ohne die eigene Linie zu verlieren: Wer kooperationsbereit bleibt und dennoch seine Werte vertritt, schafft die Basis für eine stabile Partnerschaft.
Teilverkäufe 2025: Die aktuelle Trends
Teilverkäufe spielen in der Nachfolge-Welle 2025 eine große Rolle. Immer mehr Inhaber entdecken hybride Übergangsmodelle, anstatt direkt ganz zu verkaufen (Quelle: ma-review.de).
Private-Equity-Investoren werben aktiv um Familienunternehmen, indem sie maßgeschneiderte Beteiligungen anbieten – z.B. 60-80 % Übernahme, wobei die Alteigentümer in der Übergangszeit noch an Bord bleiben und später ein zweiter Verkauf erfolgt. Diese „Partnerschaft auf Zeit“ wird häufig als Win-Win gesehen: Der Unternehmer sichert die Nachfolge und profitiert von der Wachstumsexpertise des Investors, während der Investor Zugang zum Mittelstand erhält. Auch Minderheitsbeteiligungen werden salonfähig: Plattformen und Börsen (z.B. nexxt-change oder DUB Unternehmensbörse) erleichtern es, Investoren für Unternehmensanteile zu finden (Quelle: mittelstandsbund.demittelstandsbund.de). Die Beteiligungsbörse Deutschland adressiert gezielt den bisher wenig beachteten Markt für Minderheitsbeteiligungen im Mittelstand, was zeigt, dass hier Bewegung reinkommt.
3. Management-Buy-Out und Management-Buy-In
Bei einem Management-Buy-Out (MBO) übernehmen Führungskräfte aus dem eigenen Unternehmen – etwa Geschäftsführer oder Bereichsleiter – die Anteile des bisherigen Eigentümers. Beim Management-Buy-In (MBI) kommt ein externes Managementteam oder ein einzelner Manager neu ins Unternehmen, übernimmt die Anteile und führt den Betrieb künftig selbst.
Beide Modelle gelten als attraktive Nachfolgelösung, besonders für Verkäufer, die den Fortbestand ihres Unternehmens sichern und es in kompetente, unternehmerisch denkende Hände legen wollen. Im Fall eines MBO kennt das Management das Unternehmen bereits – Prozesse, Kunden und Kultur müssen nicht neu aufgebaut werden. Beim MBI bringt das neue Management frische Perspektiven und unternehmerische Energie mit ein.
Da MBO/MBI-Kandidaten meist nicht über viel Eigenkapital verfügen, sind diese Transaktionen in der Regel zu einem größeren Teil fremdfinanziert oder wird ein weiterer Investor mit an Bord genommen.. Zum Einsatz kommen klassische Bankdarlehen, Beteiligungsgesellschaften oder spezialisierte Investoren – etwa Search Funds, die gezielt Nachfolgen begleiten. Auch hybride Modelle, bei denen der Verkäufer zunächst beteiligt bleibt, sind möglich, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten.
Für wen eignen sich MBO/MBI?
Ein MBO bietet sich an, wenn ein starkes internes Team vorhanden ist und der Inhaber eine kontinuitätsorientierte Nachfolge bevorzugt. Viele Familienunternehmer schätzen die Idee, dass langjährige Führungsmitarbeiter – die vielleicht schon Jahre zum Erfolg beigetragen haben – das Ruder übernehmen.
Ein MBI kommt in Betracht, wenn es intern keinen geeigneten Nachfolger gibt. Statt den Betrieb an x-beliebigen externen Investor zu verkaufen, sucht man gezielt nach einer führungswilligen Person von außen, die das Unternehmen übernimmt. Oft sind das erfahrene Manager aus der Branche oder Unternehmensgründer, die nach einer neuen Herausforderung suchen.
MBI ist besonders relevant in Branchen oder Regionen, wo familienfremde Nachfolger rar sind – laut IHK und KfW wird der MBI heute als typische Lösung gesehen, wenn keine internen Nachfolger da sind.
Management-Buy-Out: Verkauf an das eigene Management
Beim Management-Buy-Out (MBO) übernimmt das bestehende Führungsteam das Unternehmen. Für Verkäufer bietet diese Lösung Vertrauen und Kontinuität: Die Nachfolger sind vertraut, kennen Prozesse, Kunden und Mitarbeitende – operative Brüche sind unwahrscheinlich. Auch emotional fällt der Abschied oft leichter, wenn das Unternehmen in bekannte Hände übergeht.
Ein MBO wird von Mitarbeitenden meist positiv aufgenommen, da kein externer Käufer eingreift. Für die übernehmenden Manager ist es eine unternehmerische Chance: Sie gestalten künftig selbst, partizipieren wirtschaftlich und sind stärker motiviert.
Die Verhandlungen verlaufen oft konstruktiv: Man kennt sich, spricht offen über Zahlen und findet Lösungen – etwa Verkäuferdarlehen oder Ratenmodelle –, die einen fairen, tragfähigen Deal ermöglichen. So wird Nachfolge zur gemeinsamen Zukunftslösung.
Was sind die Risiken und Herausforderungen beim MBO?
Die größte Hürde ist meist die Finanzierung. Kaum ein Manager kann den Kaufpreis aus eigenen Mitteln stemmen. Ein Mix aus Bankkrediten, Beteiligungskapital oder Investoren ist erforderlich. Das führt häufig zu einem Leveraged Buy-Out: Das Unternehmen trägt Schulden, die aus künftigen Gewinnen bedient werden müssen. Bleibt der Erfolg aus, wird es finanziell eng.
Für Verkäufer bedeutet das oft, dass nicht der gesamte Kaufpreis sofort fließt. Häufig bleibt man über Jahre finanziell verbunden, etwa durch Earn-outs oder Verkäuferdarlehen.
Zudem braucht es einen echten Rollenwechsel: Die bisherigen Führungskräfte müssen vom Manager zum Unternehmer werden. Dazu gehören auch Verantwortung, strategisches Denken und externes Verhandlunggespür. Wer diese Kompetenzen nicht mitbringt, gefährdet den Erfolg nach der Übergabe.
Auch die interne Dynamik ist entscheidend: In MBO-Teams müssen Aufgaben und Zuständigkeiten klar geregelt sein. Fehlende Abstimmung oder Loyalitätskonflikte können das Unternehmen destabilisieren.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein MBO
- Frühzeitige Planung und Kandidatenwahl
Der Verkäufer sollte frühzeitig potenzielle Nachfolger im Management identifizieren und gezielt auf die Rolle vorbereiten – fachlich wie strategisch. - Einbindung in Führungsverantwortung
Künftige Käufer müssen nach und nach in unternehmerische Entscheidungen einbezogen werden, um das nötige Know-how und Selbstvertrauen aufzubauen. - Vertrauen und Kommunikation
Eigentümer und Managementteam müssen offen über Zeitpläne, Erwartungen und Unterstützungsangebote sprechen – nur so entsteht ein tragfähiger Übergabeprozess. - Realistische und nachhaltige Finanzierung
Die Finanzierungsstruktur sollte sorgfältig geplant werden – meist aus Eigenkapital, Bankdarlehen und ggf. mezzaninen Mitteln wie Verkäuferdarlehen zusammengesetzt. - Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Auch nach der Übernahme muss genug Liquidität im Unternehmen bleiben – sonst fehlt Spielraum für Investitionen und Weiterentwicklung. - Klare Rollenverteilung bei externer Beteiligung
Wenn Investoren eingebunden sind, sollte geregelt sein, welche Entscheidungsbefugnisse beim Management bleiben – sonst droht Abhängigkeit statt unternehmerischer Freiheit. - Transparente Kommunikation im Unternehmen
Mitarbeiter frühzeitig informieren und in den Prozess einbinden – das stärkt Vertrauen und reduziert Unsicherheit bei der Belegschaft.
Management-Buy-In: Externe Manager als Nachfolger
Beim Management-Buy-In (MBI) übernimmt ein unternehmensfremder Käufer die Firma – häufig ein erfahrener Manager oder Unternehmer, teils auch ein externes Team, das von Investoren unterstützt wird. Für viele Verkäufer ist das eine attraktive Lösung, wenn sich im eigenen Unternehmen keine Nachfolge findet.
Ein MBI bietet die Chance auf frischen Unternehmergeist: Externe Manager treten oft mit hoher Motivation und klarer Vision an, weil sie das Unternehmen als persönlichen Wendepunkt sehen – als Schritt in die eigene unternehmerische Verantwortung. Im Idealfall vereinen sie zwei Stärken: den Blick von außen, der neue Potenziale sichtbar macht, und den Respekt vor dem Bestehenden, der Kontinuität sichert.
Der häufigste Beweggrund auf Käuferseite: Der Wunsch, selbst Unternehmer zu werden – jedoch ohne die Risiken einer Neugründung. Bestehende Unternehmen mit funktionierender Infrastruktur, eingespieltem Team und soliden Kundenbeziehungen gelten als attraktive Einstiegsoption. Verkäufer treffen damit auf Kandidaten, die nicht nur qualifiziert, sondern auch emotional investiert sind – ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor.
Viele MBI-Kandidaten bringen außerdem Kapital oder Investoren mit. So lassen sich nicht nur die Kaufpreise realisieren, sondern auch gleich neue Impulse setzen – etwa durch Investitionen in Produkte, Internationalisierung oder Digitalisierung.
Ein wachsender Trend in diesem Zusammenhang: sogenannte Search Funds. Dabei sammeln junge Unternehmer gezielt Kapital von Investoren, um anschließend ein Mittelstandsunternehmen zu erwerben und langfristig zu führen. Dieses Modell verbindet Nachfolge mit Unternehmertum und wird auch in Deutschland zunehmend relevant.
Für den Verkäufer heißt das: Auch ohne familieninterne Lösung kann das Lebenswerk fortgeführt werden – durch Menschen, die mit Überzeugung und Zukunftsorientierung übernehmen.
Was sind die Risiken und Herausforderungen beim MBI?
Ein MBI ist oft risikoreicher als ein MBO – vor allem, weil der neue Eigentümer von außen kommt. Das bringt mehrere Herausforderungen mit sich:
- Integrationsrisiko:
Der neue Geschäftsführer kennt weder Mitarbeitende noch Kunden oder Prozesse. Vertrauen muss erst aufgebaut werden. Fehler oder Fehleinschätzungen in der Anfangsphase sind wahrscheinlicher. - Kulturelle Reibung:
Ein externer Führungsstil kann mit der bestehenden Unternehmenskultur kollidieren, besonders in familiengeprägten Firmen. Das Risiko für Konflikte steigt, wenn Werte, Tonlage oder Entscheidungswege nicht zusammenpassen. - Komplexe Finanzierung:
Wie beim MBO ist Kapitalbeschaffung zentral. Oft wird ein MBI gemeinsam mit Investoren realisiert, etwa wenn ein Private-Equity-Fonds Kapital stellt und einen passenden Geschäftsführer sucht. Dadurch entstehen mehr Parteien mit unterschiedlichen Interessen, was vertraglich sauber geregelt werden muss. - Risiko der Fehlbesetzung:
Wenn sich nach der Übergabe herausstellt, dass der neue Eigentümer nicht passt – sei es menschlich oder fachlich – ist der Verkäufer meist schon raus. Die Folgen können gravierend sein. Eine sorgfältige Auswahl ist daher essenziell. - Abhängigkeit von Dritten:
Kommt der Deal nicht zustande – etwa weil der Kandidat abspringt oder die Finanzierung scheitert – beginnt die Nachfolgesuche von vorn. Auch wenn ein Teil des Kaufpreises an künftige Erträge geknüpft ist, trägt der Verkäufer weiter Mitverantwortung.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein MBI
- Den richtigen Nachfolger auswählen
Ein MBI-Kandidat sollte nicht nur fachlich überzeugen, sondern auch unternehmerisch denken, zur Kultur passen und langfristig planen. Branchenkenntnis, Führungserfahrung und Eigenkapital sind Grundvoraussetzung. - Einstieg vorbereiten, nicht überstürzen
Ideal ist ein stufenweiser Übergang: Der MBI-Kandidat steigt zunächst operativ ein und übernimmt nach und nach Verantwortung. So entsteht Vertrauen – auf beiden Seiten. - Verträge vorausschauend gestalten
Wenn externe Investoren beteiligt sind, müssen Beteiligungsverhältnisse, Entscheidungswege und Exit-Regelungen klar definiert sein. Auch Earn-out-Komponenten sollten transparent und realistisch ausgestaltet werden. - Schlüsselpersonen an Bord halten
Die zweite Führungsebene ist oft der entscheidende Stabilitätsfaktor. Wer hier Kontinuität sichert, erleichtert dem neuen Inhaber den Start erheblich. - Nach innen und außen sauber kommunizieren
Kunden, Partner und Mitarbeitende sollten früh erfahren, wer übernimmt – und warum. Persönliche Übergabe durch den Verkäufer signalisiert Vertrauen und Seriosität. - Verantwortung wirklich abgeben
Ein MBI funktioniert nur, wenn der Alt-Inhaber loslassen kann. Vertrauen ist hier wichtiger als Kontrolle.
MBI und MBO als M&A-Strategie: Aktuelle Trends
Angesichts der Nachfolgewelle setzt sich das Modell MBO/MBI 2025 deutlich stärker durch als noch vor einigen Jahren. Viele Studien belegen, dass der externe Managementkauf an Bedeutung gewinnt, weil immer weniger Junioren aus der Unternehmerfamilie nachrücken.
Doch geeignete Käufer bleiben rar.
Hier setzen MBI-Modelle an: Führungskräfte, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen wollen. Besonders gefragt sind Kandidaten mit Eigenkapital – sie bringen unternehmerisches Engagement mit und lösen Nachfolgeprobleme dort, wo intern niemand übernehmen kann.
Auch Finanzinvestoren wie Family Offices oder spezialisierte Fonds unterstützen solche Modelle, wenn ein überzeugender MBI-Kandidat bereitsteht. Ohne Managementperspektive hingegen sinkt die Investitionsbereitschaft deutlich.
In der Praxis entstehen zunehmend Matchmaking-Plattformen, die Nachfolgeunternehmen und MBI-Manager zusammenbringen.
Fazit: Welche M&A-Strategie ist die richtige für einen Verkauf?
Die Wahl der richtigen M&A-Strategie für den Unternehmensverkauf ist eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen für Unternehmer in der Nachfolgeplanung. Exit-Strategie, Teilverkauf oder MBO/MBI – welche ist die beste? Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn jede Option hat ihre Stärken und Schwächen.
Entscheidend sind Ihre persönlichen Ziele (vollständiger Ausstieg vs. weiter beteiligt bleiben), die Situation des Unternehmens (z.B. gibt es interne Nachfolger? Besteht hoher Kapitalbedarf fürs Wachstum?) und die Marktgegebenheiten.
In jedem Fall gilt: Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung und prüfen Sie alle Optionen. Lassen Sie sich von den genannten Chancen und Risiken leiten und lernen Sie aus den Praxisbeispielen, aber berücksichtigen Sie immer die Besonderheiten Ihres eigenen Unternehmens. Es ist immer sinnvoll, eine professionelle Beratung hinzuzuziehen – erfahrene M&A-Berater oder Nachfolgespezialisten können helfen, einen geeigneten Käufer zu finden, den Verkaufsprozess effizient zu strukturieren und typische Fallstricke zu vermeiden.
FAQ
Was ist eine Exit-Strategie beim Unternehmensverkauf?
Eine Exit-Strategie bezeichnet den Verkauf eines Unternehmens. Der Inhaber verkauft 100 % seiner Anteile und zieht sich operativ komplett zurück. Käufer sind meist strategische Investoren oder Private-Equity-Gesellschaften. Ziel ist häufig Altersvorsorge, Vermögensrealisierung oder ein klarer unternehmerischer Schnitt.
Was versteht man unter einem Teilverkauf des Unternehmens?
Beim Teilverkauf werden nur Teile der Firmenanteile veräußert – entweder als Mehrheitsbeteiligung (>50 %) oder Minderheitsbeteiligung (<50 %). Der ursprüngliche Eigentümer bleibt oft operativ beteiligt. Ziel ist z. B. Kapitalzufuhr, schrittweise Nachfolge oder Absicherung privater Vermögenswerte bei gleichzeitigem Fortbestehen des Unternehmens.
Was ist ein Management-Buy-Out (MBO)?
Ein Management-Buy-Out ist der Verkauf des Unternehmens an das bestehende Führungsteam. Die Nachfolger kennen das Unternehmen, was Übergaben stabil und vertrauensvoll macht. MBOs werden häufig fremdfinanziert und setzen voraus, dass die Manager bereit sind, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen – inklusive finanzieller und strategischer Risiken.
Was ist ein Management-Buy-In (MBI)?
Beim Management-Buy-In kauft ein externer Manager oder ein Team das Unternehmen und übernimmt die Geschäftsführung. Dieses Modell eignet sich, wenn es intern keine Nachfolge gibt. Risiken liegen im Integrationsprozess und der Finanzierung. Chancen ergeben sich durch frische Perspektiven und unternehmerische Ambitionen der neuen Eigentümer.